Portrait: "A few Peppers and a bit of Peace." - A young artist between Kharkiv and Mariupol.
- Korbinian Leo Kramer

- 27. Mai 2025
- 22 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 9. Aug. 2025
A portrait of Maria Dziuba, who embodies resilience and resistance through her drawings.
Read the Portrait in English
"A few Peppers and a bit of Peace." - A young artist between Kharkiv and Mariupol
A portrait of Maria Dziuba, who embodies resilience and resistance through her drawings.
Spring awakens in eastern Ukraine. The ever-returning cycle of nature knows no borders — not even in times of war. In Ukraine, a country shaped largely by Christianity, the Easter holidays are a time of hope and light. Even in 2025, more than three years into the war, this significant celebration was observed. People held fast to their customs and rituals — both in the bombed-out cities and at the frontlines. In their prayers, they remembered the fallen and those held in captivity. Baskets with blessed Easter bread were shared, and the intricately decorated Pysanky were given as gifts. According to an old Ukrainian saying, the fate of the world depends on these beautifully adorned eggs. As long as they exist, evil remains banished — or so the belief goes.
But reality is often harsher than any myth.Russian President Vladimir Putin publicly announced an Easter ceasefire — only to violate it thousands of times. According to Ukrainian sources, the military recorded over 2,900 attacks on Holy Saturday alone. These were not “holidays of peace,” but days of further escalation. Missile and drone strikes, artillery fire, skirmishes — there was no sign of calm. Ukraine had agreed to the proposed ceasefire. Russia, however, used the time primarily to move troops in the regions around Pokrovsk and Kharkiv and to prepare new offensives. Czech Foreign Minister Jan Lipavský dismissed Moscow’s maneuver as a “media stunt”:“It’s like declaring a hunger strike between breakfast and lunch — then eating candy.” Russia’s actions starkly contradicted the narrative of Easter peace that Putin and his government had tried to promote.
On Good Friday, three Iskander missiles loaded with cluster munitions struck a residential area in Kharkiv’s Osnovianskyi District. One person was killed, over 100 injured. More than 20 apartment buildings were damaged.
The past days have once again made it painfully clear how far Moscow remains from any real path toward peace. While diplomatic channels speak of ceasefires or negotiations, Ukraine continues to bear the brunt of unrelenting violence. Seldom does a day pass without new strikes. In Kyiv, rockets hit residential areas in the early hours of Thursday — nine people died. Just days before, the cities of Zaporizhzhia and Odesa were heavily bombarded. Civilian infrastructure, inhabited neighborhoods —everyday places continue to be targeted by aerial attacks.
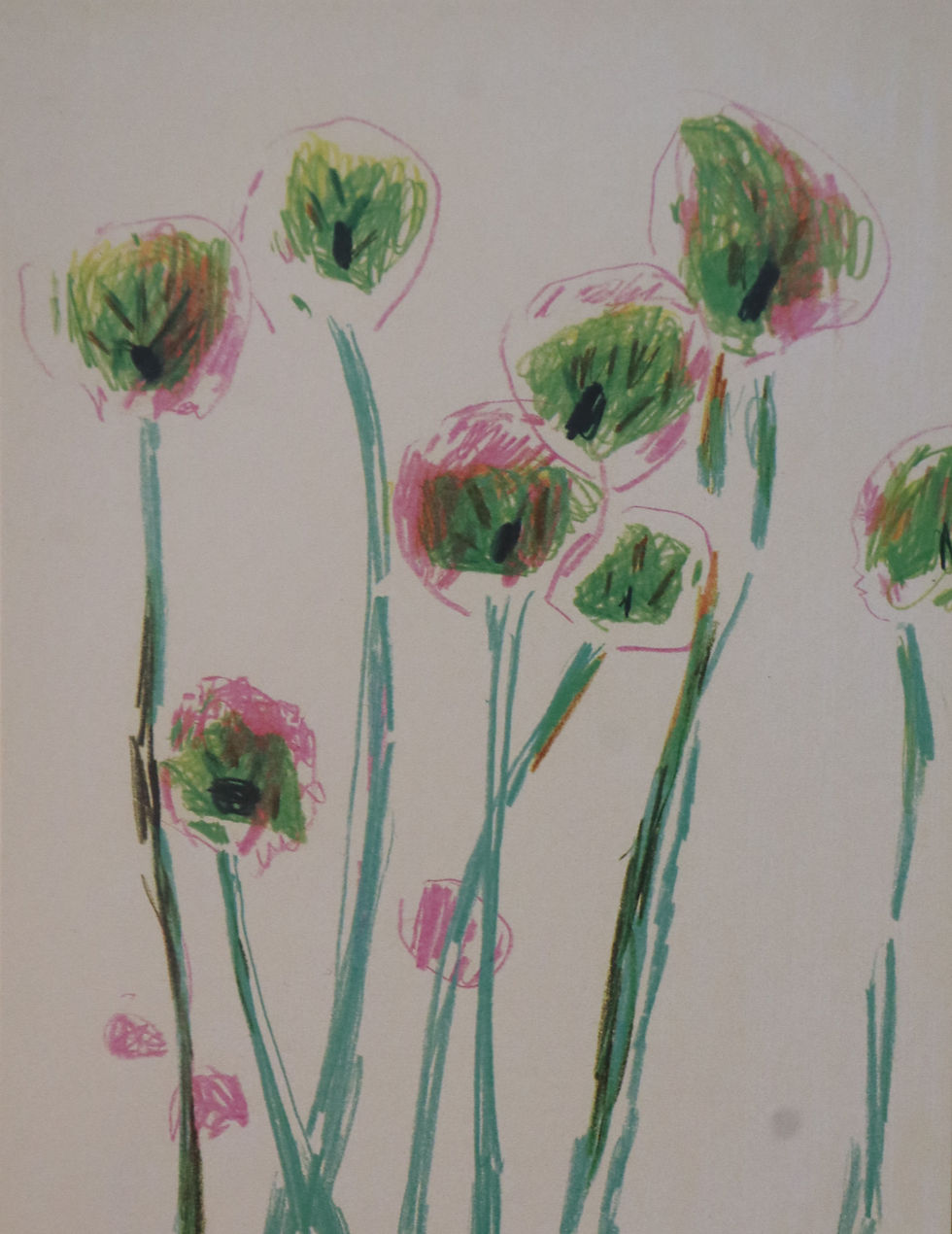
And yet: Spring has reached Kharkiv. Even in Ukraine’s second-largest city, the first flowers push through the soil, cherry trees begin to bloom, birds are singing. And in a sketchbook in the city, something else is beginning to grow. Between dense pencil lines, a garlic plant blossoms — drawn by young artist Maria Dziuba. Here, on the page, the garlic has already taken root.
Maria’s life — like that of so many Ukrainians — was turned upside down by the Russian invasion.“Mariupol is my home,” the 28-year-old says softly, as if she needs to say it out loud once more to reassure herself that this place is not just a memory. Mariupol — her city by the Sea of Azov, once familiar, now out of reach. The war has scattered her family. Her mother and younger sister now live in Dresden. Maria herself fled Kharkiv at the start of the Russian invasion in 2022, where she had completed her studies just the year before.
It was in Kharkiv that she had met her partner. Together, they lived in an apartment on the city’s outskirts — until the war reached their street. On March 2, 2022, a bomb struck nearby. That very night, they fled the city. First, a stop near Poltava, then days on the train before finally arriving in Lviv.
“It was a truly uncertain time,” Maria recalls. No one knew whether Kharkiv would fall. In Lviv, they found an apartment — and, for a time, something like safety. They lived with Maria’s brother, who had come from Poland to help the family escape Mariupol. “It was a very difficult time,” she says, “but in the end, we found work, met wonderful people. I associate a lot of warmth with that chapter of my life — and with those who supported us.” Lviv became a place of refuge. For the first time in a long while, she no longer felt like she was running — but like she had arrived.
But that safety proved relative. After a year and a half, her partner, a painter, returned to Kharkiv — for work, for family. Maria followed him.Back to a city that remains an almost daily target of missile and drone attacks.
Maria spreads one of her sketchbooks across the table. The cover is crumpled, some pages slightly warped. “We bought it on my birthday,” she says. “The day we arrived in Lviv — March 11, just over two weeks after the war began, three years ago.” She begins to flip through the pages — portraits, suggested faces, some captured in just a few lines. “I tried to deal with my stress by drawing these people. I imagined they were in a safe place, that their families would find them.” It was her way of resisting the war — with lines, colors, and imagination. But many pages remain blank. “I tried, but most of the time it was just too much.”

The sketches are not all of strangers. “This is my grandfather,” she says, pointing to the lined face of an older man. For a long time, the family had lost contact with him — until they learned he was still alive. Shortly after, he passed away. What remains is memory.
Some of these drawings — flowers, faces, and figures — later found their way onto postcards, designed by the young artist herself. These postcards became another outlet for her to express and share emotions, even as the world around her continued to fall apart.
Maria studied at the Academy of Arts in Kharkiv, earning her bachelor’s degree in book design in 2021. After graduating, she worked for a few months at a small printing house. “We did everything — from deciding the image size and paper to developing the story.” Then the invasion came.
In Lviv, she tried to establish herself as a freelance designer — remote assignments, graphic work on screen. But it wasn’t enough. “I need to see people. Also for my work.” What she missed in western Ukraine was the human contact, the direct exchange, the feeling of creating something together.
Maria now earns her living at Tripichcha in Kharkiv. In the small restaurant that reimagines Ukrainian classics, she works as a server and contributes her creativity to the interior design. “Sometimes I create things for the restaurant, sometimes just for myself. And sometimes I just sit there and look at the vegetables. That can be surprisingly calming and inspiring. A few peppers and a bit of quiet.”
Then she laughs. It’s the first time something light enters her voice. Maria appears composed, even though she speaks openly about the exhaustion that the war brings — both physical and emotional. “I think I was depressed at the start of the Russian invasion. It felt like everything was over. But now, three years later, that end still hasn’t come. My body has gotten used to the constant stress. After all this time, of course I still feel tired, sometimes low — but that’s just part of who I am,” she says with a faint smile. She describes how, over time, she’s developed an inner resilience. “Now I feel a strong force within me that allows me to offer calm and support to others in these difficult times. I feel the belief and the hope that we can achieve what we deserve — our freedom.”
Her boyfriend has not been drafted into the military so far. Maria speaks cautiously about his decision to respond to the war in a different way. “He chose a different path. But I think I may be braver than he is. Because I’m more willing to fight for my country. Because this is all I have.”
Maria’s thoughts often revolve around the question of how to continue her life in the face of war. She had considered changing course entirely, joining the military — but then doubt crept in.
She’s aware of the different paths she could take — it’s something people around her talk about as well. “I don’t know. It’s really a complicated situation, but part of me is trying to tell myself: I’m a young woman, I live in the now, and I could leave.” Her boyfriend would leave the country if Russia occupied it. There are also different opinions within her family. She understands all of that — the need for distance, for safety. But for her, another feeling outweighs it all: the certainty that she is needed, that she has to stay no matter what. “Soldiers are fighting for your life — you have to support them, in every way you can. There’s only this one path,” she says. The responsibility she feels is greater than fear. Greater than any other option. It’s about the country. And about not looking away.
Maria’s voice is calm, but clear. Steady. “Before the war, I thought I needed to see another part of the world — just to observe how life works there. Now I feel more and more strongly that I have to be in my country, because it’s really important for me to be here — to feel everything and to be with my people.”
The idea of living permanently somewhere else — in Germany, with her mother and sister, for example — is hard for her to bear. “I really felt terrible when I went to visit them in Dresden a few times. There was no feeling of home. No echo. No sense of recognition. It was really hard to be there. To not feel the same things the others do. Because they’re not living through what you’re living through.” Maria carries her memories, her story, all the ruptures the war has brought with it. She can’t imagine simply throwing herself into another life, another culture. She wants to stay true to herself. “So much is changing here. And you can’t feel it if you’re not living it.” She emphasizes that it would be wrong to run away from herself. “You can’t run from yourself,” she says firmly. “If you do, you’ll never change anything. It’s just a way of lying to yourself.”
Living elsewhere — it’s something she simply cannot imagine. “People might be kind, but they can never make you feel truly at home.” For Maria, Ukraine is more than just the place she comes from — it’s part of who she is. “Only here can I speak my language and claim my rights as a Ukrainian citizen.”
Peace is a rare state for Maria. “My health isn’t as good as it used to be,” she admits. “Of course, I need rest now and then,” she says. “But then I feel like I have to do something, I have to act.”
It’s not enough, she says, to just talk about things — about everything that’s going wrong. “It’s important to be informed. And even more important: to take action.” For her, that’s not just a phrase — it’s how she lives her life every day.
Maria talks about the complicated relationship many people have with their country — a legacy of the Soviet era, she says. “They don’t feel like masters of their own land.” People live side by side, they function somehow, but without a deeper connection to the place they’re in. “Living somewhere, doing something — but without the sense that everything is connected.”
This feeling of alienation, of not belonging, runs through many of the conversations she has. It’s as if there’s a lack of awareness that a country is more than just its government, more than its institutions — that it’s also one’s own home.
She doesn’t believe in passive hope. “Do, don’t just dream. There are people who try to build something, like my boss at Tripichcha, Mykyta Virchenko.”
Given the long frontlines and the complex reality of war, Maria talks about the need to unify efforts within the country. “It’s easy to say that we need to take Russian territory,” she says. “But answers like that are too simple for what we’re actually going through. It’s not about quick fixes, but about thoughtful, long-term strategies.”
For Maria, the real challenge lies not only in military operations but in the cohesion of the population. She emphasizes how important it is for people to understand that the fight for freedom and the country’s security is a collective responsibility. “Those who stand alone will, in critical moments, neither find the right path to resistance nor be able to sustain those around them,” she says.
Maria draws parallels to the Ukrainian partisan groups that fought against Soviet rule and oppression during and after the Second World War. “Many were eliminated by the regime. But the resistance endured and ultimately helped shift the balance of power,” she says. This striving for self-determination still resonates deeply with the young artist. In her belief, true change can only come from within, from one’s own country. “Otherwise, you lose touch with reality — with what’s happening right now in your country, which is under occupation,” she explains.
A special figure who accompanies Maria in her thoughts is her namesake, Maria Savchyn — author and protagonist of the book Thousands of Roads. A woman who, in the mid-20th century, dedicated many years of her life to guerrilla warfare against Soviet occupation. “She only survived because she felt the strength of community,” Maria says. “It was hard, but she endured. Only if we stand together can we survive as a free Ukrainian state.”
For her, these stories are not romanticized retrospectives, but realistic models for resistance: not as solitary acts, but as collective, deeply rooted decisions. She’s not talking about heroic gestures, but about perseverance — in everyday life, in solidarity.
“I believe it’s the right decision to stay in Kharkiv for now and continue contributing here,” Maria says, even though deep inside she feels a longing for her roots by the Sea of Azov. “I feel connected to the Donetsk region, and I miss that place very much,” she says. In her resolve, she resembles those who once resisted from the shadows as partisans. “If I can’t save my homeland, maybe I would still return and at least try to do something from there. At the same time, it’s hard for me to imagine such a future,” she says. “I hope it never comes to that.”
Then she says a sentence that lingers in the air:"I think I want to stay here until I die, because it’s my home – and I feel that even more strongly after everything that has happened since this phase of the war began."
Her expression turns serious as she speaks about the danger of defeat."If we lose, it will be a catastrophe. Like in Soviet times. Terror for everyone who thinks differently."That’s why the fight is necessary – even for those who aren’t on the front lines."I try to support the army. But I’m not part of it. I can’t tell them what to do." But she knows what she has to do: stay. Draw. Work. Endure.
Maria often thinks of her family – her aunt, who lives in Druzhkivka near the front line close to Kramatorsk, and her grandmother, who remains in Russian-occupied territory near Mariupol."We hope and we hold on," she says, with a mixture of sorrow and determination. These people – her family – are the ones who drive her to keep going.
But the future remains uncertain."I keep trying, but I’m not a particularly well-organized person," Maria says about herself."Sometimes I feel like a robot, missing that fire in my eyes, that feeling of knowing what you’re living for."But she also knows how important it is to set goals – especially in uncertain times."It’s crucial to make plans, to keep your dreams alive, no matter the circumstances. Even when I’m tired, the act of doing something, of trying to create change, gives me hope."
The young artist dreams of returning to a free Mariupol, a city deeply scarred by years of bombardment."Everything has changed there, of course. But the way I feel now, Mariupol remains the place where I can find peace – even if that peace exists only in my thoughts today."
Maria has now rented a small studio space in Kharkiv – nothing big, but it’s a place of her own. When she’s not working at the Tripichcha, she draws there. In those moments, she doesn’t feel like someone who’s merely enduring.She feels like someone who is creating. Someone who stays.
In all her thoughts and worries, one thing remains constant: her deep connection to her homeland."I long for a future where the war finally ends, where we can live in peace again, in our country, on our own land."
Even in the cityscape of Kharkiv, by early June, the small pink blossoms of the garlic plant will begin to sprout again – flowers Maria knows all too well.
Das Porträt auf Deutsch
„Ein paar Paprika und ein wenig Ruhe“ – eine junge Künstlerin zwischen Charkiw und Mariupol"
Ein Porträt über Maria Dziuba, die Resilienz und Widerstand in ihren Zeichnungen lebt.
Im Osten der Ukraine erwacht der Frühling. Der immer wieder kehrende Zyklus der Natur kennt keine Grenzen, auch nicht in Zeiten des Kriegs. In der Ukraine, einem mehrheitlich christlich geprägten Land, sind die Feiertage rund um Ostern eine Zeit der Hoffnung und des Lichts. Auch 2025, inmitten des mittlerweile über drei Jahre andauernden Krieges wurde dieses bedeutende Fest gefeiert. Die Menschen hielten an ihren Bräuchen und Ritualen fest - in den bombardierten Städten ebenso wie an der Front. In ihren Gebeten gedachten sie der gefallenen sowie der in Gefangenschaft befindlichen Soldaten, Körbe mit gesegnetem Osterbrot wurden verteilt und die bedeutungsvollen Pysanky verschenkt. Einer alten ukrainischen Weisheit zufolge hängt das Schicksal der Welt an diesen kunstvoll verzierten Ostereiern. Solange sie existieren, bleibt das Böse gebannt – so heißt es.
Doch die Realität ist oft härter als jeder Mythos. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte medienwirksam eine Feuerpause zu Ostern angekündigt – und sie tausendfach gebrochen. Laut ukrainischen Angaben registrierte das Militär allein am Karsamstag über 2.900 Angriffe auf ihr Staatsgebiet. Es waren keine „Feiertage des Friedens“, sondern Tage weiterer Eskalation. Raketen- und Drohnenangriffe, Artilleriefeuer, Gefechte – von Ruhe keine Spur. Die Ukraine hatte dem Vorschlag einer Feuerpause zugestimmt. Russland hingegen nutzte die Zeit vor allem um in den Gebieten um Pokrowsk und Charkiw Truppenbewegungen durchzuführen und neue Offensiven vorzubereiten. Der tschechische Außenminister Jan Lipavský kommentierte diese Täuschung seitens Moskaus als „medialen Stunt“: „Es ist, als würde man zwischen Frühstück und Mittagessen einen Hungerstreik ausrufen und dann Süßigkeiten essen.“ Russlands Taten widerlegten die Behauptung von einem Osterfrieden, den Putin und seine Regierung propagierten.
Am Karfreitag schlugen drei Iskander-Raketen mit Streumunition in einem Wohnviertel im Osnovianskyi District in Charkiw ein. Eine Person kam ums Leben, über 100 wurden verletzt. Mehr als 20 Wohnhäuser wurden beschädigt.
Auch die vergangenen Tage haben erneut gezeigt, wie weit Moskau von jeder Form friedlicher Annäherung entfernt ist. Während auf diplomatischer Ebene von Waffenruhe oder Verhandlungen gesprochen wird, trifft die Realität die Ukraine mit unverminderter Härte. Kaum ein Tag vergeht ohne Einschläge. In Kiew schlugen in der Nacht zum Donnerstag Raketen in Wohngebiete ein, neun Menschen starben. Wenige Tage zuvor wurden die Städte Saporischschja und Odessa schwer getroffen. Zivile Infrastruktur, bewohnte Viertel – es sind Orte des Alltags, die immer wieder ins Visier von Luftangriffen geraten.
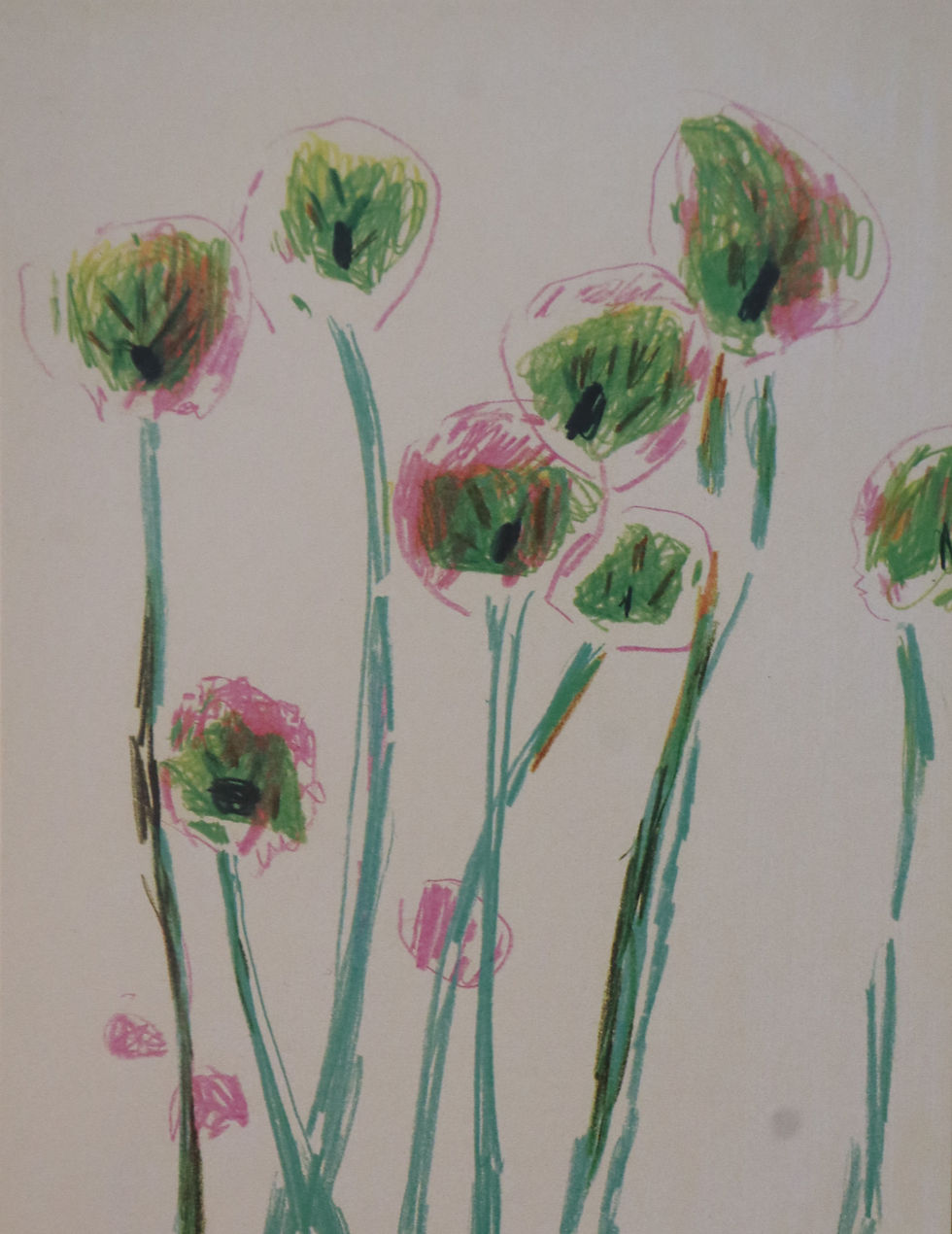
Und dennoch: Der Frühling hat auch Charkiw erreicht.. Auch in der zweitgrößten Stadt der Ukraine sprießen erste Blümchen durch die Erde, die Kirschbäume beginnen zu blühen, Vögel zwitschern. Auch in einem Skizzenblock in der Stadt beginnt etwas zu wachsen. Zwischen dichten Bleistiftlinien blüht eine Knoblauchpflanze - gezeichnet von der jungen Künstlerin Maria Dziuba. Hier, auf dem Papier hat der Knoblauch längst Wurzeln geschlagen.
Marias Leben hat sich so wie das vieler Ukrainerinnen und Ukrainer mit der russischen Invasion auf den Kopf gestellt. "Mariupol ist meine Heimat“, sagt die 28-Jährige leise. So, als müsse sie das noch einmal aussprechen, um sich zu vergewissern, dass dieser Ort nicht bloß Erinnerung ist. Mariupol – ihre Stadt am Asowschen Meer, einst vertraut, heute unerreichbar. Der Krieg hat die Familie zersplittert. Ihre Mutter und die kleine Schwester leben inzwischen in Dresden. Sie selbst floh zu Beginn der russischen Invasion 2022 aus Charkiw, wo sie im Jahr vorher ihr Studium abgeschlossen hatte.
In der ostukrainischen Stadt hatte sie ihren Freund kennengelernt. Gemeinsam lebten sie in einer Wohnung am Stadtrand – bis der Krieg ihre Straße erreichte. Am 2. März 2022 schlug eine Bombe in unmittelbarer Nähe ein. Noch in derselben Nacht verließen sie die Stadt. Erst ein Zwischenstopp nahe Poltawa, dann tagelange Zugfahrt, Ankunft in Lwiw.
"Es war wirklich eine unsichere Phase“, erinnert sich Maria. Niemand wusste, ob auch Charkiw fallen würde. In Lwiw fanden sie eine Wohnung und für eine Weile so etwas wie Sicherheit. Sie lebten mit ihrem Bruder, der aus Polen gekommen war, um der Familie zu helfen, aus Mariupol zu fliehen. „Es war eine sehr schwere Zeit“, sagt sie, „aber schließlich fanden wir Arbeit, trafen wunderbare Menschen. Ich verbinde viel Wärme mit dieser Lebensetappe – und mit denjenigen, die uns damals unterstützt haben.“ Lwiw wurde zu einem Ort der Zuflucht. Sie fühlte sich zum ersten Mal seit langem nicht mehr gehetzt, sondern angekommen.
Doch die Sicherheit war relativ. Nach anderthalb Jahren zog es ihren Freund, einen Maler, zurück nach Charkiw – wegen der Arbeit, der Familie. Maria folgte ihm. Zurück in eine Stadt, die fast täglich Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen war.
Maria breitet eines ihrer Skizzenbücher auf dem Tisch aus. Der Einband ist zerknittert, einige Seiten leicht gewellt. „Wir haben es an meinem Geburtstag gekauft“, sagt sie. „Der Tag, an dem wir in Lwiw ankamen, der 11. März, gut zwei Wochen nach Kriegsbeginn vor drei Jahren.“ Sie beginnt zu blättern – Porträts, angedeutete Gesichter, manche nur mit wenigen Strichen festgehalten. „Ich versuchte, meinen Stress zu bewältigen, indem ich diese Menschen zeichnete. Ich stellte mir vor, dass sie an einem sicheren Ort sind und ihre Familien sie finden werden.“ Es war ihr Versuch, dem Krieg etwas entgegenzusetzen – mit Linien, Farben, Vorstellungskraft. Doch viele
Seiten blieben leer. „Ich habe es versucht, aber meist war es mir zu viel.“ Die Skizzen zeigen nicht nur Fremde. „Das ist mein Großvater“, sagt sie und zeigt auf ein altes Männergesicht. Lange hatte die Familie keinen Kontakt zu ihm, bis sie erfuhren, dass er noch lebte. Wenig später starb er. Die Erinnerung bleibt.

Einige dieser Zeichnungen, darunter Blumen, Gesichter und Figuren, fanden später ihren Platz auf Postkarten, die die junge Künstlerin selbst gestaltet. Diese Postkarten wurden für sie zu einer weiteren Möglichkeit, ihre Emotionen auszudrücken und mit anderen zu teilen, während die Welt um sie herum weiter zerbrach.
Maria studierte an der Kunstakademie in Charkiw. 2021 machte sie ihren Bachelor in Buchgestaltung. Nach dem Abschluss arbeitete sie ein paar Monate für einen kleine Druckerei. „Wir haben alles gestaltet - von der Bildgröße über das Papier bis hin zur Geschichte.“ Dann kam die Invasion.
In Lwiw versuchte sie, als freiberufliche Designerin Fuß zu fassen – Aufträge aus der Ferne, grafische Arbeiten am Bildschirm. Aber es reichte ihr nicht. „Ich muss Menschen sehen. Auch für die Arbeit.“ Der Kontakt, der direkte Austausch, das gemeinsame Tun – all das fehlte in der Westukraine.
Inzwischen verdient Maria ihr Geld im Tripichcha in Charkiw. In dem kleinen Restaurant, das ukrainische Klassiker neu interpretiert, serviert sie und bringt ihre Kreativität in die Gestaltung des Raumes mit ein.„Mal für das Lokal, mal einfach für mich selbst. Und manchmal sitze ich einfach nur da und betrachte das Gemüse. Das kann ziemlich entspannend und inspirierend sein. Ein paar Paprika und ein wenig Ruhe.“
Dann lacht sie. Es ist das erste Mal, dass sich etwas Leichtes in ihre Stimme mischt.
Maria wirkt gefasst, auch wenn sie offen über die Erschöpfung spricht, die der Krieg mit sich bringt – körperlich wie seelisch. „Ich glaube, zu Beginn der russischen Invasion war ich depressiv. Es fühlte sich an, als wäre alles vorbei. Aber jetzt, drei Jahre später, ist dieses Ende noch immer nicht eingetreten. Der Körper hat sich an den konstanten Stress gewöhnt. Nach all der Zeit fühle ich mich natürlich oft müde, manchmal auch niedergeschlagen, aber das gehört zu meiner Natur“, sagt sie mit einem leichten Schmunzeln. Sie beschreibt, wie sie inzwischen eine innere Stärke entwickelt hat. „Mittlerweile spüre ich auch eine starke Kraft in mir, die es mir ermöglicht, anderen in diesen schweren Zeiten Ruhe und Unterstützung zu geben. Ich fühle den Glauben und die Hoffnung, dass wir das erreichen können, was uns zusteht – unsere Freiheit.“
Ihr Freund wurde bislang nicht zum Militär eingezogen. Maria spricht vorsichtig über seine Entscheidung, den Krieg anders zu beantworten. „Er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Aber ich denke ich bin vielleicht mutiger als er. Weil ich eher dazu bereit bin, für mein Land zu kämpfen. Denn das ist alles, was ich habe.“
Marias Gedanken kreisen oft um die Frage, wie sie ihr Leben im Angesicht des Krieges weiterführen soll. Sie hatte überlegt, ihren Lebensweg zu ändern, in die Militärs zu gehen, doch dann kam der Zweifel.
Sie kennt die verschiedenen Wege, die sie gehen könnte – auch in ihrem Umfeld wird darüber diskutiert. „Ich weiß es nicht. Es ist wirklich eine komplizierte Situation, aber ein Teil in mir versucht mir zu sagen: Ich bin eine junge Frau, ich lebe im Jetzt und kann gehen“. Ihr Freund würde das Land im Falle einer russischen Besatzung verlassen. Auch in ihrer Familie gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Sie versteht all das – das Bedürfnis nach Abstand, nach Schutz. Doch überwiegt für sie ein anderes Gefühl: das Wissen, dass sie gebraucht wird, dass sie in jedem Fall bleiben muss. „Soldaten kämpfen für dein Leben – du musst sie unterstützen, auf jede erdenkliche Weise. Es gibt nur diesen einen Weg“, sagt sie. Die Verantwortung, die sie empfindet, ist größer als die Angst. Größer als jede andere Option. Es geht um das Land. Und darum, nicht wegzusehen.
Marias Stimme ist ruhig, aber klar. Fest. „Vor dem Krieg dachte ich, dass ich eine andere Welt sehen müsste, einfach um mal zu beobachten, wie es dort funktioniert. Nun spüre ich immer deutlicher, dass ich in meinem Land sein muss, weil es wirklich wichtig für mich ist, hier zu sein, um all das zu fühlen und mit meinen Mitmenschen zusammen zu sein.“
Die Vorstellung, dauerhaft woanders zu leben – in Deutschland, bei ihrer Mutter und Schwester etwa – ist für sie schwer erträglich. „Es ging mir wirklich schlecht, als ich ein paar Mal zu ihnen nach Dresden gefahren bin. Da war kein Gefühl von Zuhause. Kein Echo. Kein Wiedererkennen. Es war wirklich schwer, dort zu sein. Nicht das gleiche zu empfinden wie die anderen. Weil sie nicht das erleben, was du erlebst.“ Maria trägt ihre Erinnerungen, ihre Geschichte, all die Zerwürfnisse, die der Krieg mit sich gebracht hat in sich. Sie kann sich kein einfaches Hineinwerfen in ein anderes Leben, in eine andere Kultur vorstellen. Sie möchte authentisch bleiben. „Hier verändert sich so viel. Und man kann es nicht fühlen, wenn man es nicht lebt.“ Sie betont, dass es falsch wäre, vor sich selbst zu fliehen. „Du kannst nicht vor dir selbst weglaufen” sagt sie bestimmt. „Wenn du das tust, wirst du niemals etwas verändern. Es ist nur eine Art, sich selbst zu täuschen.“ Anderswo zu leben – das kann sie sich nicht vorstellen. „Die Menschen mögen freundlich sein, aber sie können dir nie das Gefühl geben, wirklich zu Hause zu sein.“ Für Maria ist die Ukraine mehr als nur ihr Herkunftsland, sie ist Teil ihrer Identität. „Nur hier kann ich meine Sprache sprechen und meine Rechte als ukrainische Staatsbürgerin wahrnehmen.“
Ruhe ist für Maria ein seltener Zustand. „Meine Gesundheit ist nicht mehr so gut wie noch vor einiger Zeit“, gibt sie zu. „Natürlich brauche ich hin und wieder etwas Erholung“ sagt sie. „Aber dann habe ich das Gefühl, ich muss etwas tun, ich muss handeln.“
Es sei nicht genug, nur über die Dinge zu reden, über das, was schiefläuft. „Es ist wichtig, Bescheid zu wissen. Und noch wichtiger: aktiv zu werden.“ Für sie ist das keine Floskel, sondern gelebter Alltag.
Maria spricht über das schwierige Verhältnis vieler Menschen zu ihrem Land – ein Erbe der Sowjetzeit, wie sie sagt. „Sie fühlen sich nicht als Herren ihres eigenen Landes.“ Man lebe nebeneinander, funktioniere irgendwie, aber ohne tiefere Verbindung zu dem Ort, an dem man sei. „Im Irgendwo leben, irgendetwas tun - aber ohne das Gefühl, dass alles miteinander verbunden ist.“
Dieses Gefühl der Entfremdung, des Nicht-Dazugehörens, zieht sich für sie durch viele Gespräche. Es sei, als fehle das Bewusstsein dafür, dass ein Land mehr ist als Regierung, mehr als Verwaltung – dass es auch das eigene Zuhause ist.
Sie glaubt nicht an passives Hoffen. „Tun – nicht nur träumen. Es gibt Menschen, die versuchen, etwas aufzubauen, wie mein Chef aus dem Tripichcha, Mykyta Virchenko.“
Angesichts des langen Frontverlaufs und der komplexen Kriegsrealität spricht Maria über die Notwendigkeit, die Kräfte im Land zu bündeln. „Es ist leicht, zu sagen, wir müssten russisches Territorium einnehmen“, sagt sie. „Aber solche Antworten sind zu simpel für das, was wir tatsächlich erleben. Es geht nicht um schnelle Lösungen, sondern um durchdachte, langfristige Strategien.“
Für Maria liegt die wahre Herausforderung nicht nur in den militärischen Operationen, sondern auch im Zusammenhalt der Bevölkerung. Sie betont, wie wichtig es sei, dass die Menschen verstehen, dass der Kampf für die Freiheit und die Sicherheit des Landes eine kollektive Verantwortung ist. „Wer allein steht, wird in entscheidenden Momenten weder den richtigen Weg zum Widerstand finden noch das Umfeld halten können“, sagt sie.
So zieht Maria Parallelen zu jenen ukrainischen Partisanengruppen, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Untergrund heraus gegen die sowjetische Herrschaft und deren Unterdrückung kämpften. „Viele wurden vom Regime liquidiert. Doch der Widerstand blieb bestehen und trug letztlich dazu bei, Machtverhältnisse zu verändern“, sagt sie. Dieses Streben nach Selbstbestimmung berührt die junge Künstlerin bis heute. Ihrem Glauben nach ist eine Veränderung nur von innen heraus, aus dem eigenen Land möglich. „Andernfalls verlierst du den Bezug zur Realität – zu dem, was gerade in deinem Land passiert, das nun besetzt ist“, erklärt sie.
Eine besondere Figur, die Maria in ihren Gedanken begleitet, ist ihre Namensvetterin Maria Savchyn, die Autorin und Protagonistin des Buches Thousands of Roads. Eine Frau, die Mitte des 20. Jahrhunderts viele Jahre ihres Lebens dem Guerillakampf gegen die sowjetische Besatzung widmete. „Sie überlebte nur, weil sie die Stärke der Gemeinschaft spürte“, erzählt Maria. „Es war hart, aber sie hielt durch. Nur wenn wir zusammenhalten, können wir als freier ukrainischer Staat bestehen.“
Diese Geschichten sind für sie kein romantischer Rückblick, sondern ein realistisches Modell für den Widerstand: nicht als einsamer Akt, sondern als kollektive, tief verankerte Entscheidung. Es geht ihr dabei nicht um heldenhafte Gesten, sondern um Standhaftigkeit – im Alltag, im Miteinander.
„Ich denke, es ist die richtige Entscheidung, vorerst in Charkiw zu bleiben und hier weiter meinen Beitrag zu leisten” sagt Maria, obwohl sie tief in sich eine Sehnsucht nach ihrem Ursprung am Asowschen Meer spürt. „Ich fühle mich mit der Region Donezk verbunden, und ich vermisse diesen Ort sehr”, erzählt sie. In ihrer Haltung erinnert sie an jene, die einst als Partisanen aus dem Verborgenen Widerstand leisteten. „Wenn ich meine Heimat nicht retten kann, würde ich vielleicht dennoch zurückkehren und zumindest versuchen, von dort aus etwas zu bewegen. Zugleich fällt es mir schwer, an eine derartige Zukunft zu denken“, sagt sie. „Ich hoffe, dass es niemals so weit kommt.“
Dann sagt sie einen Satz, der in der Luft hängen bleibt: „Ich denke, ich möchte hier bis zu meinem Tod bleiben, weil es mein Zuhause ist, und ich spüre es umso stärker nach allem, was passiert ist, seitdem diese Phase des Krieges begonnen hat.“
Ihr Blick wird ernst, als sie über die Gefahr einer Niederlage spricht. „Wenn wir verlieren, wird es eine Katastrophe sein. Wie zu Sowjetzeiten. Terror für alle, die anders denken.“ Deshalb müsse man kämpfen. Auch wenn man nicht an der Front stehe. „Ich versuche, der Armee zu helfen. Aber ich bin nicht Teil der Armee. Ich kann ihnen nicht sagen, was sie zu tun haben“
Aber sie weiß, was sie selbst tun muss: Bleiben. Zeichnen. Arbeiten. Aushalten.
Maria denkt immer wieder an ihre Familie: an ihre Tante, die in Druzhkivka nahe der Frontlinie bei Kramatorsk lebt, an ihre Großmutter, die sich im von russischen Truppen besetzten Gebiet bei Mariupol aufhält. „Wir hoffen und halten zusammen“, erklärt sie mit einer Mischung aus Trauer und Entschlossenheit. Diese Menschen - ihre Familie - sind es, die sie antreiben, weiterzumachen.
Aber die Zukunft bleibt ungewiss. „Ich versuche es immer wieder, aber ich bin kein besonders gut organisierter Mensch“, beschreibt Maria sich selbst. „Manchmal fühle ich mich wie eine Roboterin, der dieses Feuer in den Augen fehlt, dieses Gefühl, wofür man lebt.“ Aber sie weiß, wie wichtig es ist, sich Ziele zu setzen – gerade in unsicheren Zeiten. „Es ist entscheidend, Pläne zu schmieden, sich Träume zu bewahren, ganz gleich unter welchen Umständen. Auch wenn ich müde bin, gibt mir das Gefühl, etwas zu tun, etwas zu verändern, Hoffnung.”
Die junge Künstlerin träumt von einer Rückkehr in ein freies Mariupol, eine Stadt, die von den Bombardierungen der letzten Jahre schwer gezeichnet wurde. „Alles hat sich dort verändert, natürlich. Aber so wie ich mich jetzt fühle, bleibt Mariupol der Ort, an dem ich zur Ruhe finde – auch wenn diese Ruhe heute nur in meinen Gedanken existiert.“
Maria hat sich in Charkiw mittlerweile ein kleines Atelier gemietet - nichts Großes, aber ein Ort, der ihr gehört. Wenn sie nicht im Tripichcha arbeitet, zeichnet sie dort. In diesen Momenten fühlt sie sich nicht wie jemand, der nur aushält. Sondern wie jemand, der etwas schafft. Jemand, der bleibt.
In all ihren Gedanken und Sorgen bleibt eines konstant: die tiefe Verbundenheit mit ihrer Heimat. „Ich sehne mich nach einer Zukunft, in der der Krieg endlich endet, in der wir wieder in Frieden leben können, in unserem Land, auf unserem eigenen Boden.“
Auch im Stadtgebiet Charkiw werden ab Anfang Juni wieder die kleinen, rosa Blüten der Knoblauchpflanze aus der Erde sprießen - Blumen, die Maria nur allzu gut kennt.








